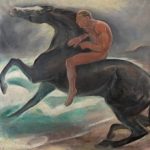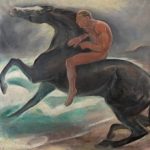 Es beginnt mit diesem Bild auf einer Kunstpostkarte. Überreicht von einem Fürther, der seine dienstlichen Berlin-Aufenthalte gerne mit dem Besuch von Museen verbindet. Und es endet mit der Wiederentdeckung eines Künstlers, dessen Wurzeln in Fürth liegen: Benno Berneis (1883 – 1916).
Es beginnt mit diesem Bild auf einer Kunstpostkarte. Überreicht von einem Fürther, der seine dienstlichen Berlin-Aufenthalte gerne mit dem Besuch von Museen verbindet. Und es endet mit der Wiederentdeckung eines Künstlers, dessen Wurzeln in Fürth liegen: Benno Berneis (1883 – 1916).
Unter dem Titel „Späte Rückkehr“ präsentierte die Berlinischen Galerie erstmals seit knapp hundert Jahren wieder dessen Werke. Berneis war ein Weggefährte von Henri Matisse und Max Beckmann. „Der Maler, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts Berlin zu seiner künstlerischen Wirkungsstätte gewählt hatte, stellte dort mit den bedeutendsten Künstlern des Impressionismus und Expressionismus aus. Er galt der Kunstkritik seiner Zeit als hoffnungsvolles Talent und begann in Berlin, einen eigenen, künstlerischen Stil zu entwickeln“, heißt es im Begleittext zur Ausstellung, deren Grundlage eine private Schenkung ist.
Schon 1902 zieht Berneis zum Kunststudium nach München, 1905 nach Berlin. Dort hat er Kontakte zu den Kollegen Lovis Corinth und Max Slevogt. Er ist Teil des Vorstands der 1914 gegründeten „Freien Sezession“ um den Künstler Max Liebermann. Bereits damals zählte die Kunstkritik ihn „zu den Künstlern, die die schöpferische Phantasie spielen ließen und ihre Visionen mit der ehrlichsten Licht- und Farbenkunst durcharbeiteten“.
Umso tragischer ist für die Kunstwelt dann sein früher Kriegstod. Aus einem Nachruf: „Berneis´Schaffen schließt mit einer großen Frage an das Schicksal, schließt mit der Frage an die Zukunft…die nun keine Antwort mehr finden wird. Denn der Tod hat Berneis in der entscheidenden Stunde den Pinsel aus der Hand genommen…Er war im Begriff, Klarheit zu gewinnen über den Weg, den er zu gehen hatte.“
Begleitend zur Berliner Ausstellung ist dann auch eine Publikation erschienen, die an die Werke junger Künstler erinnert, die, wie Berneis, Opfer des Ersten Weltkrieges wurden. Sein Schicksal: Er wurde als Feldflieger im Alter von 33 Jahren abgeschossen und auf dem Soldatenfriedhof von Mont-Saint-Rémy in den Ardennen beigesetzt. So wie seine Künstlerkollegen Franz Marc und August Macke aus der „Blauer Reiter“-Bewegung hat er ein durch seinen Tod jäh abgebrochenes Werk hinterlassen. „Verglühte Träume“, die im Katalog anschaulich beschrieben werden. Berneis war, wie so viele andere junge deutsche Juden, begeistert in den Ersten Weltkrieg gezogen, als Elitekämpfer und Flieger. Sein Name fand sich vor zwei Jahren auch in einer Ausstellung im Jüdischen Museum München, die unter dem Titel „Krieg! Juden zwischen den Fronten“ dieses patriotische Engagement von rund 100 000 jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg schilderte.
Fast gleichzeitig zur Berliner Ausstellung hat sich auch ein Autor von „FürthWiki“ mit dem bisher kaum erforschten Leben von Benno Berneis befasst. Dort ist zu lesen, dass dieser am 9. Mai 1883 als Sohn des jüdischen Fabrikbesitzers Albert Berneis und seiner Frau Betty Berneis in Fürth geboren ist. Sein Vater hatte 1875 zusammen mit seinem Onkel Louis die Fürther Schuhfabrik B. Berneis gegründet, aus der 1892 die Vereinigten Fränkischen Schuhfabriken Berneis-Wessels mit Niederlassungen in Nürnberg und Herzogenaurach entstanden. Nach dem Besuch der Volksschule war Benno Berneis Schüler am Humanistischem Gymnasium in Fürth. Dort war er auch Mitglied der Schülerverbindung Abituria. 1890 verlegte die Familie ihren Wohnsitz nach Nürnberg.

Benno Berneis während seiner Militärdienstzeit 1901
Dass das Werk von Benno Berneis so lange in Vergessenheit geriet, hängt, so ein Hinweis
im Katalog, auch mit dem weiteren Verlauf der deutschen Geschichte zusammen: „Nach
dem Ende des Ersten Weltkriegs übernahm die Schwester von Berneis seinen Nachlass.
Sie war als junge Witwe eines französischen Malers gerade nach Deutschland
zurückgekehrt und musste zunächst vor allem den Neuanfang in ihrem Leben bewältigen.
Ab 1933 wurde sie als Jüdin von den Nationalsozialisten verfolgt und nahm sich unter
diesem Druck – nachdem ihre Flucht nach Japan nicht mehr geglückt war – 1942 das Leben.
Ihren Besitz und das Erbe ihres Bruders vertraute sie einem Freund an, der alles auf dem
Dachboden des Hauses bewahrte. Hier fiel das Erbe lange Jahre dem Vergessen anheim.
Die heutigen Nachkommen haben den Besitz dann der Berlinischen Galerie übergeben.
Im Moment sind die Werke dort leider nicht mehr in der Dauerausstellung. Aber die Schenkung und die Publikation haben ihn und sein künstlerisches Wirken aus dem Dornröschenschlaf geholt. Und die Fürther können stolz sein auf einen weiteren bedeutenden Sohn ihrer Stadt.